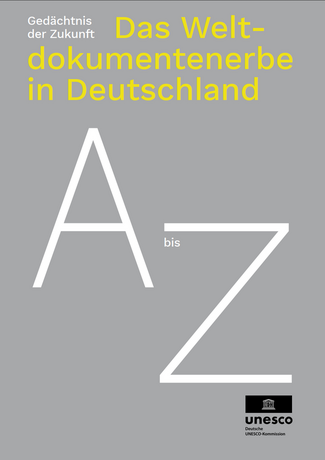Zeichnungen und Schriften von Kindern und Jugendlichen in Kriegszeiten in Europa 1914-1950
Fakten
- Aufnahmejahr: 2025
- Standorte: Museum Elbinsel Wilhelmsburg, Hamburg (Deutschland)Externer Link:, Musée de Montmartre, Paris (Frankreich)Externer Link:, Institut für Personengeschichte Bensheim (Deutschland)Externer Link:, National Arts Education Archive | Yorkshire Sculpture Park (Vereinigtes Königreich)Externer Link:, Schulmuseum Nürnberg / Schulgeschichtliche Sammlung der Universität Erlangen Nürnberg (Deutschland)Externer Link:, Archives of Ontario, Toronto (Canada)Externer Link:, Hezkuntzaren Museoa/Museo de la Educación de la UPV/EHU (Universität des Baskenlandes), San Sebastián (Spanien)Externer Link:, Stadtmuseum Landeshauptstadt Düsseldorf (Deutschland)Externer Link:, Mémorial de la Shoah, Paris (Frankreich)Externer Link:, Židovské muzeum v Praze (Jüdisches Museum, Prag ) (Tschechien)Externer Link:, Bibliothèque nationale de France / Maison d’Izieu (Frankreich)Externer Link:, Archiv für Zeitgeschichte ETH Zürich (Schweiz)Externer Link:, Musée National de l’Éducation, Rouen (Frankreich)Externer Link:, Stiftung Pestalozzianum, Pädagogische Hochschule Zürich (Schweiz)Externer Link:, Archiwa Państwowe, Warschau (Polen)Externer Link:, Stadtarchiv Saarbrücken (Deutschland)Externer Link:, Stiftung Kinderdorf Pestalozzi, Trogen (Schweiz)Externer Link:,
- UNESCO-Webseite: Memory of the World RegisterExterner Link:
- Webseite zu den Dokumenten: siehe unten im Text
Durch ihre Kreativität, den Reichtum an Motiven und ihre direkte Sprache bieten die Dokumente zahlreiche Anknüpfungspunkte für den Dialog ebenso wie für Mitgefühl. Es handelt sich um ein demokratisches Erbe der städtischen Kulturen und ländlichen Gebiete Europas, das von Jungen und Mädchen unterschiedlichen Alters und aus verschiedenen sozialen Schichten geschaffen wurde. Entstanden sind universelle Zeugnisse verschiedener Kulturen, die wertvolle Überlieferungen für künftige Generationen darstellen.
Die Zeichnungen und Schriften geben einen tiefen Einblick in Biografien, Privatleben, soziale Veränderungen und kulturelle Wendepunkte der Geschichte. Sie öffnen ein Fenster in die Vergangenheit und führen zu bewegenden Visionen der Welt, wie sie von jungen Menschen gesehen und erlebt wurde. Oft sind die Zeichnungen und Schriften die einzigen Spuren, die von ihnen hinterlassen wurden – insbesondere von jenen, die Krieg und Massenmord zum Opfer gefallen sind.
Alle Sammlungen werden von einer qualitativen und vollständigen Beschreibung ihres Ursprungs, ihrer Quellen und der Art und Weise, wie sie erworben oder entdeckt wurden, begleitet. Dazu gehören auch Informationen über die Person oder Institution, die die Objekte ursprünglich gesammelt hat, sowie über mögliche spätere Besitzer oder Kuratoren. Ebenso werden Informationen über den Zeitraum, in dem die Zeichnungen entstanden sind, sowie über ihren sozialen, politischen und kulturellen Kontext bereitgestellt.
Auflistung der Dokumente mit Standorten:
DER 1. WELTKRIEG (1914 – 1918) UND SEINE FOLGEN
Museum Elbinsel Wilhelmsburg, Hamburg (Deutschland):
Musée de Montmartre, Paris (Frankreich):
Institut für Personengeschichte Bensheim (Deutschland):
National Arts Education Archive | Yorkshire Sculpture Park (Vereinigtes Königreich):
Schulmuseum Nürnberg / Schulgeschichtliche Sammlung der Universität Erlangen Nürnberg (Deutschland):
DER SPANISCHE BÜRGERKRIEG (1936 – 1939)
Archives of Ontario, Toronto (Canada):
und hierExterner Link:.
Hezkuntzaren Museoa/Museo de la Educación de la UPV/EHU (Universität des Baskenlandes), San Sebastián (Spanien):
KINDER UND JUGENDLICHE IM HOLOCAUST
Stadtmuseum Landeshauptstadt Düsseldorf (Deutschland):
Mémorial de la Shoah, Paris (Frankreich):
Židovské muzeum v Praze (Jüdisches Museum, Prag ) (Tschechien):
und hierExterner Link:.
Bibliothèque nationale de France / Maison d’Izieu (Frankreich):
Archiv für Zeitgeschichte ETH Zürich (Schweiz):
DER 2. WELTKRIEG (1939 – 1945) UND SEINE FOLGEN
Musée National de l’Éducation, Rouen (Frankreich):
Stiftung Pestalozzianum, Pädagogische Hochschule Zürich (Schweiz):
Archiwa Państwowe, Warschau (Polen):
Stadtarchiv Saarbrücken (Deutschland):
und hierExterner Link:.
Stiftung Kinderdorf Pestalozzi, Trogen (Schweiz):