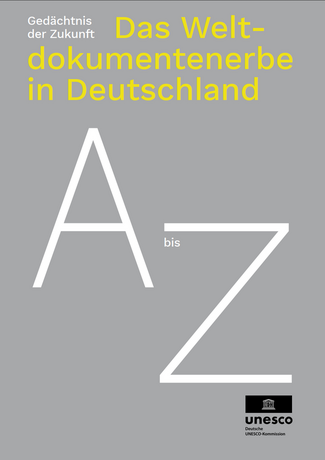Münchner Handschrift des Babylonischen Talmud
Fakten
- Aufnahmejahr: 2025
- Standort: Bayerische StaatsbibliothekExterner Link:
- UNESCO-Webseite: Memory of the World RegisterExterner Link:
- Webseite zum DokumentExterner Link: oder hierExterner Link:
Der Codex hebraicus 95 der Bayerischen Staatsbibliothek, bekannt als die „Münchner Handschrift des Babylonischen Talmuds“, ist die einzige erhaltene Handschrift weltweit, die den gesamten Text umfasst. Sie bewahrt eine Textquelle von größter Bedeutung für das Judentum und einen der wichtigsten religiösen Quellentexte der Menschheit. Der Codex ist eine der wertvollsten Handschriften in der reichen Handschriftensammlung der Bayerischen Staatsbibliothek.
Die beiden Teile des Babylonischen Talmuds, die Mischna und die Gemara, wurden etwa vom 2. bis zum 8./9. Jahrhundert n. Chr. schriftlich fixiert. Die Münchner Handschrift wurde am 17. Tevet 5103 (hebräisches Datum), d. h. am 15. Dezember 1342 n. Chr., in Frankreich fertiggestellt, wie das Kolophon auf Blatt 563 verso vermerkt. Seit dem Ende des 15. Jahrhunderts befindet sich der Codex in Deutschland. Er wurde Ende des 18. Jh. vom Augustinerchorherrenstift Polling erworben und gelangte 1803 im Rahmen der Säkularisation in den Besitz der Bayerischen Staatsbibliothek. Der Codex überlebte Jahrhunderte der Verfolgung im Mittelalter, in der Neuzeit und selbst die Gräueltaten der Nazis in Deutschland und die Zerstörung der Bibliothek durch Fliegerbomben im Zweiten Weltkrieg.
Mit ihrem Kontext und ihrer Geschichte bildet diese Handschrift eine Brücke zwischen Orient und Okzident und ist von wahrhaft globaler Bedeutung. Aufgrund ihrer Einzigartigkeit, ihrer Geschichte, ihres wissenschaftlichen Wertes und ihrer religiösen Bedeutung zählt die Münchner Handschrift des Babylonischen Talmuds zu den kostbarsten Buchschätzen und dem bedeutendsten dokumentarischen Erbe der Menschheit.
Die Handschrift wurde bereits 2003 von der Bayerischen Staatsbibliothek vollständig digitalisiert. Sie wird im Katalog und in den Digitalen Sammlungen der Bibliothek, in der Deutschen Digitalen Bibliothek und auch in der World Digital Library (WDL) präsentiert.