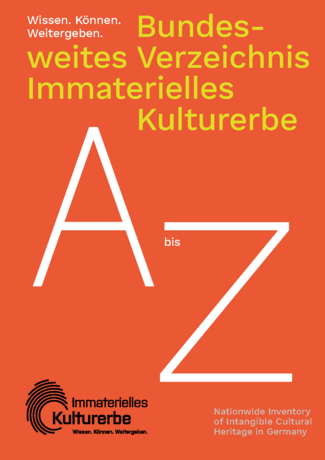Anlage und Pflege von Flechthecken
Fakten
- Aufnahmejahr: 2018
- Verbreitung: deutschlandweit, hauptsächlich im Raum Nieheim (Nordrhein-Westfalen)
- Zentraler Termin: Spätwinter bis Frühjahr
- Bereiche: Gesellschaftliche Bräuche, Rituale und Feste; Wissen und Bräuche in Bezug auf die Natur und das Universum; traditionelle Handwerkstechniken
Im Raum Nieheim hat sich die Technik des Heckenflechtens bis heute erhalten. Unabdingbar für die Anlage und Pflege von Flechthecken ist die Beherrschung der Technik der Verknotung von dünnen Weidenruten, die von Generation zu Generation weitergegeben wird. Nach ungefähr sieben Jahren wird die Hecke wieder neu eingebunden, eventuelle Ausfälle werden dabei repariert. Bei der Neuanlage werden zwischen Kopfweiden einreihig überwiegend Haseln und einzelne Weißdornpflanzen gesetzt, andere Gehölze siedeln sich mit der Zeit von selber an.
Jedes Jahr im Spätwinter bis Frühjahr werden die Hecken neu eingebunden. Kopfweiden liefern die zum Flechten benötigten dünnen, einjährigen Weidenruten. Zuerst wird Holz aus den Haseln herausgeschnitten, welches zu dick oder zu alt oder zu dicht gewachsen ist. Einige stärkere Stöcke bleiben stehen, werden in Brusthöhe abgesägt und dienen als Pfosten für die drei waagerechten Lagen zu denen die verbliebenen, etwa besenstieldicken Äste gebogen werden. Für die unterste Lage werden die Äste, alle in die gleiche Richtung, möglichst nah zum Boden, etwa Kniehöhe, herabgedrückt, die unter Druck stehenden Äste an mehreren Stellen mit Weidenruten zusammengebunden und so an anderen Stöcken befestigt, dass sie ihre Stellung beibehalten. Die Knoten werden dabei immer auf der Seite der Eigentümer gebunden. Ziel ist eine möglichst schmale, gleichmäßige Hecke mit einer Höhe von ungefähr 1,50 m.
Bildergalerie Flechthecken
Als lebende Zäune sparen die Flechthecken Bauholz ein und sind sie vorwiegend in Landschaften mit vorherrschender Weidewirtschaft zu finden. Mit Einführung des Stacheldrahtes im 20. Jahrhundert begann in den meisten Landschaften auch der Rückgang der Flechthecken. Sie wurden durch Drahtzäune ersetzt und das Wissen um die Technik des Heckenflechtens verschwand zunehmend.
Zahlreiche Funktionen werden von Flechthecken erfüllt: Sie grenzen Grundstücke voneinander ab, sind Schattenspender für das Vieh, liefern Brenn- und Nutzholz sowie Haselnüsse und Futter. Seit einigen Jahren werden verwilderte Hecken wieder gepflegt, um das Landschaftsbild aufzuwerten und die vielseitigen Vorteile der Hecken zu nutzen. Heute stellt die Kulturform einen großen ökologischen Mehrwert für die Tier- und Pflanzenwelt dar. Vögel erhalten neuen Lebensraum, Igel, Hasen, Siebenschläfer oder die Haselmaus und Rebhühner finden Brut- und Nistplätze. Im Rahmen der jährlichen Aktionen der Region Nieheim bekommen Interessierte, speziell auch Kinder und Jugendliche, die Möglichkeit die Flechttechniken praxisnah kennenzulernen.
Kontakt
Heimatverein Nieheim e.V.
Ulrich Pieper
E-Mail
HomepageExterner Link: