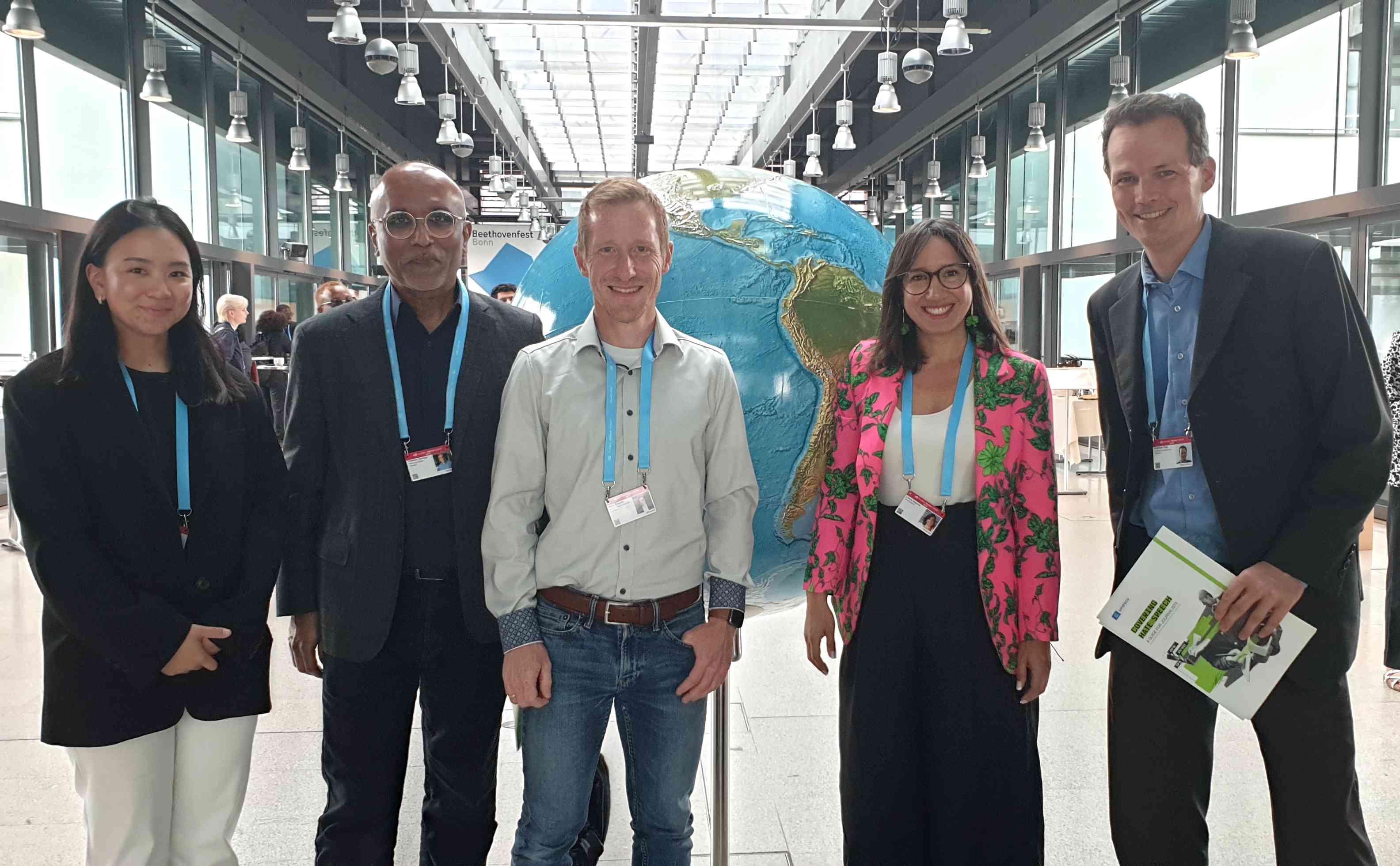Externer Link: CC BY 4.0
Beispiele für den Einsatz Künstlicher Intelligenz in den UNESCO-Erbeprogrammen
Im Rahmen der erneut unter der Schirmherrschaft der Deutschen UNESCO-Kommission ausgerichteten dreitägigen Konferenz „Zugang gestalten! Mehr Verantwortung für das kulturelle Erbe“ fand am Vormittag des 23. Oktober 2025 in der Deutschen Nationalbibliothek in Leipzig das Panel „Ethik der Künstlichen Intelligenz und Beispiele aus der Praxis“ statt.
Fotos
In dem von der Deutschen UNESCO-Kommission organisierten Panel stellte eingangs Jeannine Hausmann, Leiterin des Fachbereichs Internationale Zusammenarbeit und Zukunftsfragen der Deutschen UNESCO-Kommission, die UNESCO-Empfehlung zur Ethik der Künstlichen Intelligenz (KI) vor (Videoaufzeichnung des VortragsExterner Link:).
Die im November 2021 von den 193 UNESCO-Mitgliedsstaaten verabschiedete Empfehlung ist das erste globale völkerrechtliche Instrument zur KI-Ethik. Darin wird KI unter starker Betonung der Menschenrechte holistisch als Gesellschaftsaufgabe betrachtet. Ethische Prinzipien werden in der KI-Empfehlung mit politischen Handlungsempfehlungen verknüpft. In elf Politikbereichen finden sich konkrete Handlungsempfehlungen, darunter solche für den Bereich Kultur als auch Bildung und Forschung.
Für Archive, Bibliotheken und Museen relevant ist die enthaltene Empfehlung an die Mitgliedsstaaten, KI-Systeme zu nutzen, um das materielle, dokumentarische und Immaterielle Kulturerbe zu erhalten, zu bereichern, zu verstehen, zu fördern, zu verwalten und zugänglich zu machen (§ 94 KI-EmpfehlungHerunterladen: (PDF, 879 KB)). Technologieunternehmen und andere Interessensgruppen sollen durch die Mitgliedsstaaten einbezogen werden, um ein vielfältiges Angebot an kulturellen Ausdrucksformen und vielfältigen Zugangsmöglichkeiten zu diesen Ausdrucksformen zu fördern und insbesondere dafür zu sorgen, dass die Sichtbarkeit und Auffindbarkeit lokal verankerter Inhalte durch algorithmische Empfehlungen verbessert wird (§ 98 KI-EmpfehlungHerunterladen: (PDF, 879 KB)). Schließlich sollen Mitgliedsstaaten Archive, Bibliotheken, Galerien und Museen auf nationaler Ebene dazu anregen, KI-Systeme zu nutzen, um auf ihre Sammlungen aufmerksam zu machen und ihre Bibliotheken, Datenbanken und Wissensbasen zu erweitern und gleichzeitig für ihre Nutzerinnen und Nutzer zugänglich zu machen (§ 100 KI-EmpfehlungHerunterladen: (PDF, 879 KB)).
KI und Welterbestätten
Als Beispiel für den Einsatz von KI im Bereich von UNESCO-Welterbestätten stellte Frau Professorin Dr. Franziska Klemstein, Inhaberin der Professur für Data Lifecycyle Management in Kultur- und Wissenschaftseinrichtungen an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig, einen von ihr in der Hochschullehre eingesetzten Entscheidungsbaum zur Priorisierung von gefährdetem Weltkulturerbe vor (Videoaufzeichnung des VortragsExterner Link:).
Mit Hilfe des kleinen Einplatinencomputers Raspberry Pi wird eine Gefährdungseinschätzung errechnet und eine entsprechende Prioritätenliste ausgegeben. Je mehr Daten zur Welterbestätte vorliegen, desto präziser kann die Gefährdungseinschätzung erstellt werden. Dies erlaubt in der Praxis von einem reaktiven Krisenmanagement zu einer vorausschauenden Resilienzplanung zu gelangen. Frau Professorin Klemstein machte abschließend deutlich, dass es einer Hybridisierung von Expertise bedarf, also der Kombination aus menschlicher und maschineller Bewertung. Generell seien offene Schnittstellen, interoperable Datenmodelle und nachvollziehbare KI-Prozesse wichtig für mehr digitale Resilienz.
KI und Weltdokumentenerbe
Frau Dr. Angela Huang, Leiterin der Forschungsstelle für die Geschichte der Hanse und des Ostseeraums (FGHO) am Europäischen Hansemuseum in Lübeck, zeigte in ihrem Vortrag, wie maschinelles Lernen den Zugang zu UNESCO-Weltdokumentenerbe am Beispiel von Hansedokumenten verändert (Videoaufzeichnung des VortragsExterner Link:).
In dem im Jahr 2020 gestarteten Citizen Science-Projekt „Hanse.Quellen.Lesen!“Externer Link: in Kooperation mit dem Archiv der Hansestadt Lübeck wird unter Beteiligung der interessierten Öffentlichkeit Grundlagenarbeit in der Hanseforschung geleistet. Dazu transkribieren rund 20 Freiwillige bisher über 5.000 Seiten Text. Mit Hilfe von Transkribus, einer Plattform zur Texterkennung, Layout-Analyse und Strukturerkennung von historischen Dokumenten, werden Hansedokumente erschlossen und transkribiert. Die digitale Lösung wird von der zweckorientierten Genossenschaft Read-Coop in Innsbruck entwickelt. Mit dem Citizen Science-Projekt zu Hansedokumenten konnten Menschen erreicht werden, die zuvor noch keinen Kontakt zu Dokumenten des späten Mittelalters hatten. Über den fachlichen Aspekt hinaus lernen die Teilnehmenden auch praktische Fertigkeiten im Umgang mit digitalen Lösungen, die sie im Alltag nutzen können.
KI und Immaterielles Kulturerbe
Für das Immaterielle Kulturerbe zeigte Carrie Lau, Doktorandin am Lehrstuhl für menschzentrierte Technologien für das Lernen an der Technischen Universität München, wie personalisierte KI zum Erlernen Immateriellen Kulturerbes am Anwendungsfall neapolitanischer PizzaExterner Link: genutzt werden kann (Videoaufzeichnung des VortragsExterner Link:).
Eingangs machte Lau deutlich, dass KI sowohl potenziell Positives wie Negatives im Kulturbereich bewirken könne. Als positiv sei der offenere Zugang und eine gesteigerte Kreativität, hingegen negativ die mögliche Vertiefung von Vorurteilen und der Verlust von Kultur zu nennen. Insbesondere der Verlust Immateriellen Kulturerbes, wie das der Bräuche und Traditionen, sei zu befürchten, wenn die Vermittlung jüngere Generationen, die im Zeitalter digitaler Medien aufwachsen, nicht erreicht. Hier sieht Lau Einsatzmöglichkeiten für generative KI und erweiterte sowie virtuelle Realität, um interaktive, sich anpassende und emotional ansprechende Wege zur Erfahrung von Kultur zu schaffen. Genau dies verfolgt das Projekt der Vermittlung der neapolitanischen Kunst des Pizzabackens, 2017 von der UNESCO in die Liste des Immateriellen Kulturerbes der Menschheit aufgenommen. Aus dem Projekt mit 54 Teilnehmenden aus vier Ländern konnte die Erkenntnis gewonnen werden, dass eine moderate KI-gestützte Interaktion die längste Aufmerksamkeitsspanne bei den Teilnehmenden erzeugte. Eine starke KI sorgte für weniger eigenes Ausprobieren. In einer Befragung zwei Wochen nach dem Einsatz der digitalen Vermittlung berichteten Teilnehmende von einem gesteigerten Interesse, mehr über die Tradition des neapolitanischen Pizzabackens zu erfahren.
Podiumsgespräch zu Chancen und Risiken des KI-Einsatzes
Im abschließenden Podiumsgespräch (VideoaufzeichnungExterner Link:) sprachen die Referentinnen über den konkreten Mehrwert von KI in der Arbeit. Oft sei man noch in der Phase des Ausprobierens, aber auch eine gewisse Angst sei verbreitet, den Anschluss an die Entwicklungen zu verlieren. Frau Prof. Klemstein machte deutlich, dass es wichtig sei, die Grundsätze offener Daten und Zugänge beizubehalten. Frau Dr. Huang regte die stärkere Differenzierung von Technik und Einsatzfällen an, um eine gezieltere Diskussion zu führen hinsichtlich sinnvoller Anwendungen. Insbesondere in den Geschichtswissenschaften könne moderne Texterkennung helfen, Quellen schneller und in größeren Umfängen zu erschließen, als das bisher der Fall war. Carrie Lau verwies auf die individuellen Lernmöglichkeiten mit Hilfe von KI-Systemen.
Zu Erwartungen, die aktuell nicht erfüllt worden sind und Problemen durch den Einsatz von KI berichtete Carrie Lau von Halluzinationen der KI und der oft zu freundlichen und gleichzeitig zu unklaren Anweisungen der KI. Außerdem könnte sich die Interaktion zwischen Menschen durch den zunehmenden Einsatz von KI-Systemen verändern bzw. reduzieren, wenn primär KI Antworten auf Fragen gebe.
Frau Professorin Klemstein berichtete von überzogenen Erwartungen beim Transcribus-Einsatz hinsichtlich der Fehlerrate bei Standardmodellen. Es müsse zunächst viel Zeit in das Training der Modelle investiert werden, um qualitativ akzeptable Ergebnisse zu erzielen. Auch bei der Bild- und Layouterkennung bzw. -analyse würden KI-Systeme noch nicht immer zufriedenstellende Ergebnisse erzielen, insbesondere wenn die Texte und das Layout älter als zehn Jahre seien.
Zur Frage der Verlässlichkeit der von KI-Systemen erzeugten Inhalte machte Carrie Lau deutlich, dass diese Frage an der Universität beachtet wird. Für das Citizen Science-Projekts „Hanse.Quellen.Lesen!“ in Lübeck versucht man die Schwelle der Teilnahmemöglichkeit möglichst gering zu halten und gleichzeitig Persönlichkeitsrechte und Datenschutz zu beachten. Frau Professorin Klemstein berichtete aus dem Bereich der Hochschullehre von der Anwendung lokaler Sprachmodelle, mit denen bewusst andere Wege gegangen werden, um mögliche Datenschutzprobleme bei der Anwendung großer Modelle zu vermeiden.
Zum Abschluss des Panels riefen die Referentinnen zum Austausch der gemachten Erfahrungen beim KI-Einsatz in den jeweiligen Fachgemeinschaften auf. Carrie Lau betonte, dass die Auswirkungen und Konsequenzen des KI-Einsatzes bereits direkt am Anfang eines Vorhabens beachtet werden sollten. Frau Professorin Klemstein regte die Arbeit in multiprofessionellen Gruppen an, um verschiedene Perspektiven zu berücksichtigen. Gerade in dem hochdynamischen Feld der KI- und Technikentwicklung sei es laut Frau Dr. Huang wichtig, Fragen zu stellen und sich kontinuierlich auszutauschen.