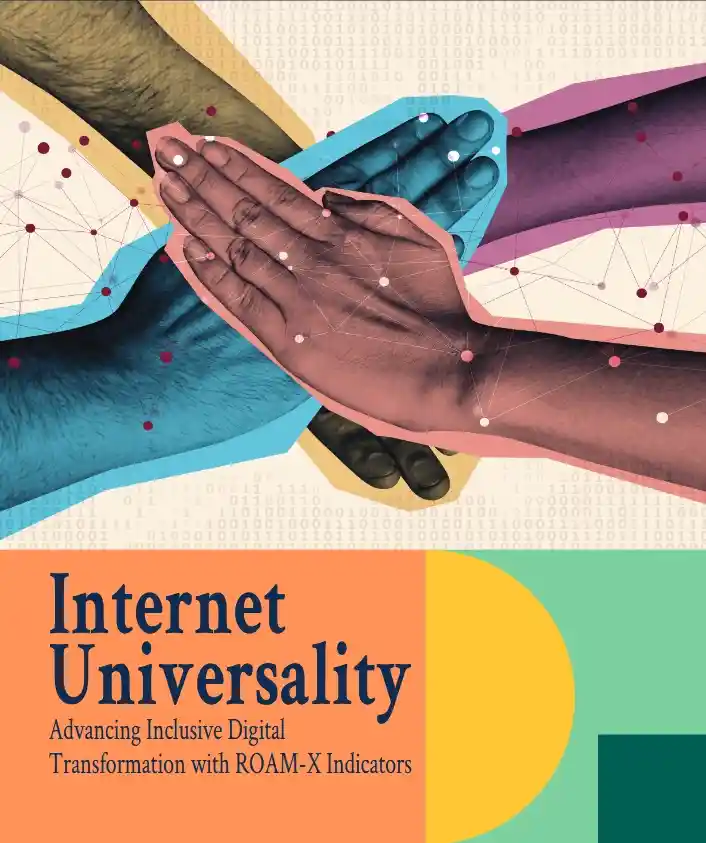

Diskussionsveranstaltung zur Rolle von KI für die Zukunft des Journalismus
Journalismus in Zeiten von Vertrauens- und Aufmerk-samkeitsverlust – welche Rolle spielt KI?
Im sehr gut besuchten Presseclub in Wien stellte Professorin Dr. Alexandra Borchardt in ihrer einführenden Keynote (Aufzeichnung bei YouTubeExterner Link:) Chancen wie auch Risiken beim Einsatz generativer künstlicher Intelligenz (KI) im Journalismus vor. Unterlegt mit Zahlen und Fakten sowie Zitaten zentraler Persönlichkeiten aus dem Medienbereich zeichnete sie das Bild einer von im Umbruch befindlichen Medienlandschaft, die den Umgang mit großen technischen Neuerungen meistern muss.
Als Hauptautorin des 2024 erschienen Berichts "Vertrauenswürdiger Journalismus im Zeitalter der generativen KIExterner Link:" der Europäischen Rundfunkunion zitierte Borchardt aus den 40 Interviews mit Führungspersönlichkeiten verschiedener Medienhäuser sowie Fachleuten für KI, die für den Bericht geführt wurden. Danach ergeben sich vielfach genannte Chancen für den Datenjournalismus, die Recherche und die Dokumenten-Analyse sowie bei der Erstellung von Inhalten. Als Beispiele für die Anwendung von KI im Medienbereich nannte Borchardt den Chatbot der BBC, ein redaktionsinternes KI-System für die Erstellung von Inhalten beim dänischen JP/Politikens Hus und einen angepassten generativen vortrainierten Transformer (GPT) für das Formulieren von Marketing-Botschaften bei der südafrikanischen Daily Maverick Internetzeitung.
KI birgt das Risiko der Halluzination, also der Generierung von falschen Informationen, die bei der Nutzung durch Medienunternehmen zu einem Vertrauensverlust, der über das einzelne Medium hinaus zu einem generellen Vertrauensverlust gegenüber Informationen und Inhalten führen kann. Frau Borchardt unterlegte diese These mit Ergebnissen einer Befragung, aus der deutlich hervorgeht, dass Menschen klar die Nutzung von KI als reine Unterstützung von Redaktionen gegenüber der primären KI-Nutzung mit etwas menschlicher Kontrolle vorziehen. Nutzende äußerten sich insbesondere im Themengebiet von Politik mit Unbehagen, wenn dort Inhalte von KI generiert würden. Am wenigsten Unbehagen gegenüber KI-generierten Inhalten konnte beim Themengebiet Sportberichterstattung nachgewiesen werden.
Abschließend machte Frau Borchardt deutlich, dass es einer Ethik für den Einsatz von KI im Medienbereich bedürfe. Dabei gelte es, den Nutzen für die Öffentlichkeit ins Zentrum zu stellen und im Zweifel auch einmal den Einsatz von KI abzulehnen. Transparenz und Regeln menschlicher Endkontrolle seien ebenso notwendig wie die KI-Alphabetisierung der Menschen. Eine Regulierung, die Schaden minimiere und gleichzeitig Innovation fördere, gelte es zu erreichen. Dabei seien Copyright und Datenschutz zu beachten, was die Zusammenarbeit der Medienbranche mit den Technologiekonzernen erfordere. Am Ende gehe es im Journalismus immer um Fakten, das Erzählen von Geschichten und darum, Menschen zu überraschen. Der Schlüssel dafür liege darin, Menschen zu treffen und ihnen zuzuhören.
Vertrauen ist unabdingbare Voraussetzung für einen erfolgreichen Journalismus, der Mächtigen und Einflussreichen auf die Finger schaut, der Orientierung in der Flut von Informationen bietet, Verbindungen schafft und Gemeinschaft stiftet. Dazu muss Journalismus Individuen und Zielgruppen entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen bedienen und somit Wert in ihren Leben schaffen. Hierzu gelte es für den Journalismus, sich auf Recherche und Analyse als Kernmerkmale zu konzentrieren.
In Zukunft kann KI die Produktionsprozesse erleichtern und automatisieren, Daten analysieren und visualisieren und damit journalistische Geschichten ermöglichen, die vorher so nicht realisierbar waren. Die Frage wird sein, ob die Menschen KI-generierte Produkte akzeptieren und nutzen werden. Wem sie vertrauen und welche Geschäftsmodelle sich durchsetzen. Wird Desinformation durch Verifikation einzudämmen sein? Gewinnen Redaktionen die Kontrolle über technische Hilfsmittel oder geben sie die Kontrolle an Technologieunternehmen ab? Wie entwickelt sich die Qualität von Sprachmodellen, die generativer KI zu Grunde liegen? Wird es nachhaltige, klimaschonende Lösungen geben und wie entwickelt sich die Attraktivität von Berufsfeldern, wenn maschinelle Lösungen in immer mehr kreative Bereiche vordringen? Mit diesen Fragen entließt Frau Borchardt das Publikum in Wien und online in die anschließende von Dr. Julia Herrnböck moderierte Podiumsdiskussion (Aufzeichnung bei YouTubeExterner Link:).
Podiumsdiskussion mit vier Fachleuten
Eingangs äußerte der Journalist Philip Meyer vom Schweizer Radio und Fernsehen SRF die Erwartung, dass KI im Journalismus auch finanziell entlasten könne, wobei der Produktivitätsgewinn derzeit noch unklar sei. Kommunikationswissenschaftlerin Dr. Theresa Körner betonte die vorhandene Angst bei der Leserschaft vor Manipulation durch KI. Dem entgegenwirken könne vorhandenes oder aufzubauendes Vertrauen in Medienmarken in Zeiten von Umbruchsituationen, in denen ein hohes Informationsbedürfnis besteht. Einladungen in Redaktionen und die Kennzeichnung von mit KI generierten Inhalten seien Möglichkeiten, um Vertrauen zu gewinnen.
In diesem Zusammenhang wies Professor Dr. Matthias Kettemann als Leiter des Instituts für Theorie und Zukunft des Rechts der Universität Innsbruck auf die Tatsache hin, dass auch für KI-generierte Inhalte das jeweils veröffentlichende Medium Haftung übernehme. Er betonte insbesondere die Notwendigkeit, den Datenschutz bei der Eingabe von Daten in KI-Systeme zu beachten. Für das SRF stellte Philip Meyer klar, dass nur solche Dinge veröffentlicht würden, die durch Menschenhand gegangen seien.
Ramona Arzberger, die als Journalistin unter anderem beim inklusiven Magazin „andererseits“ tätig ist, hob die Möglichkeiten von KI für den Transfer von Inhalten in verschiedene Formate, wie einfache Sprache, hervor. Einschränkend bemerkte sie, dass die Ergebnisse nicht immer gut sein. Dennoch könne KI ihr im journalistischen Alltag bei der Ideenfindung helfen.
Professor Kettemann zufolge gilt es beim Einsatz genauso wie bei der Konzeption von KI-Systemen, den Menschen stets in den Mittelpunkt zu setzen. Menschenrechte seien vom Anfang bis Ende des Lebenszyklus von KI-Systemen mitzudenken. Die Intervention durch die Betreibenden von KI sei immer einzuplanen, um Daten ausgleichen zu können.
Insgesamt gelte es laut Dr. Körner, nicht nur den Journalismus und die Redaktionen, sondern die Gesellschaft als Ganzes fit für den Umgang und das Leben mit KI zu machen. Der von Philip Meyer erwähnte, vom SRF für Medienschulungen durch die Schweiz fahrende Zug sei dafür ein gutes Beispiel. Einig waren sich Dr. Körner und Philip Meyer darin, dass sich Redaktionsalltag und Berufsbilder ändern, aber die benötigten journalistischen Kompetenzen mehr denn je benötigt werden.
Weitere Informationen zur Arbeit der Deutschen UNESCO-Kommission im Bereich künstliche Intelligenz.