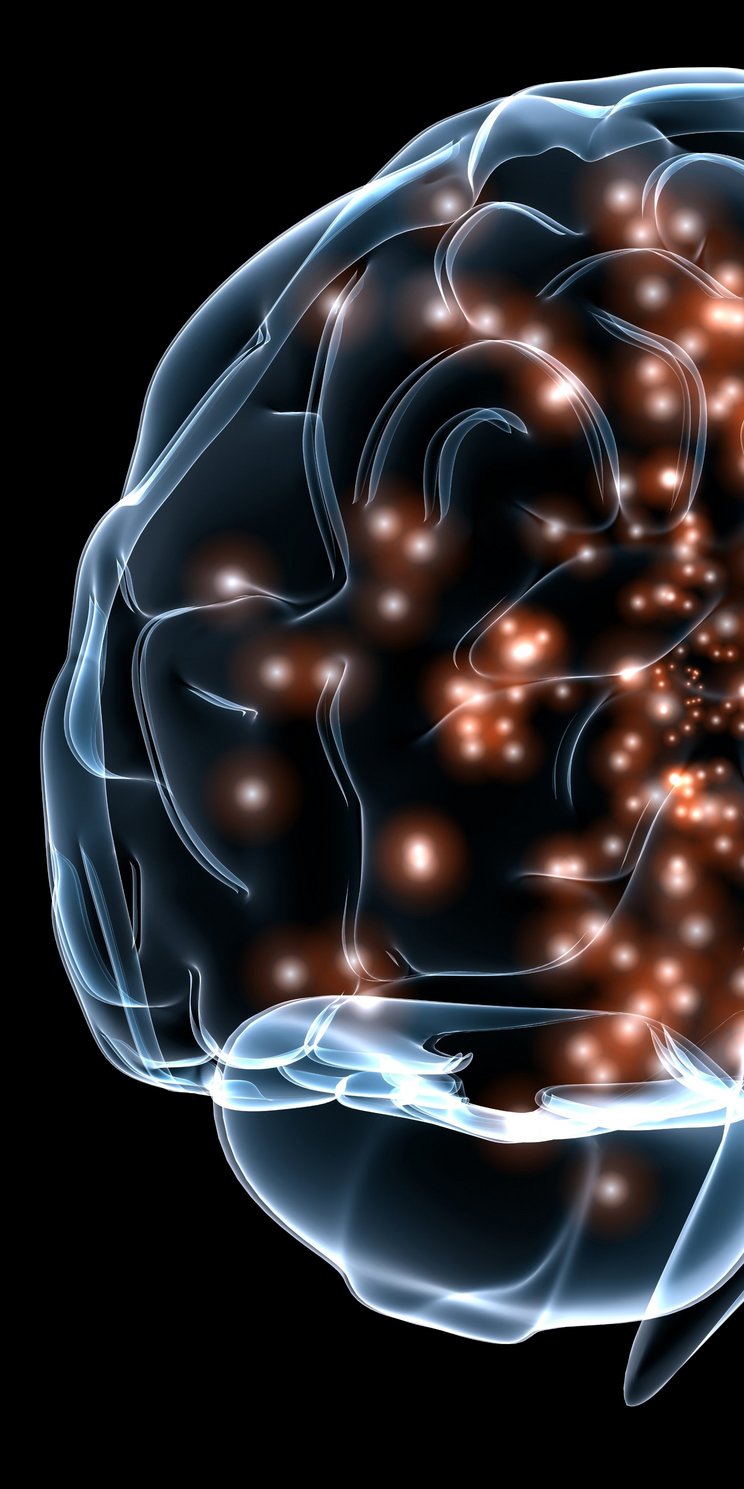Die Forschung im Bereich der Neurotechnologien hat in den letzten Jahren rasante Fortschritte gemacht. Unter Neurotechnologien versteht man Systeme an der direkten Schnittstelle zwischen Gehirn und Computer. Beispiele sind Cochlea-Implantate, mit deren Hilfe Schwerhörige und Gehörlose wieder (besser) hören können oder Hirnscanner, die „Gedanken“ an Computer oder Roboter übertragen und es so vollständig gelähmten Menschen ermöglichen, wieder mit ihrer Umwelt zu kommunizieren.
Vieles derzeit Undenkbare könnte morgen schon Alltag sein und der mögliche Nutzen dieser Technologien in der Medizin sind enorm. Groß sind jedoch auch die ethischen Fragen, die neurotechnologische Anwendungen aufwerfen: Wer hat die Rechte an den Daten, die unser Gehirn produziert, und wie lässt sich unsere Privatsphäre schützen, wenn unsere Gedanken gelesen werden? Unter welchen Umständen könnte es erlaubt sein, dass Neurotechnologien unsere Erinnerungen verändern und was würde das für unsere Identität bedeuten? Wie können wir unseren freien Willen schützen, wenn Unternehmen Techniken des Neuromarketings, d.h. des auf Neurotechnologien basierenden Produktmarketings, einsetzen?
Die übergeordnete Frage, wie wir als Gesellschaft mit Technologien umgehen, die unser Gehirn vermessen und beeinflussen können, gewinnt auch deshalb an Bedeutung, weil zunehmend Anwendungen entwickelt werden, die sich (auch) an gesunde Menschen richten. Viele davon dienen der Selbstoptimierung, wie etwa der Steigerung der Konzentration oder der Gedächtnisleistung.
UNESCO verabschiedet völkerrechtliche Empfehlung zur Ethik der Neurotechnologie
Die UNESCO-Generalkonferenz hat im November 2025 den ersten globalen Rahmen für eine ethische Entwicklung und Nutzung von Neurotechnologien verabschiedet: Die UNESCO-Empfehlung zur Ethik der NeurotechnologieExterner Link:. In der völkerrechtlichen Empfehlung werden rechtliche und gesellschaftspolitische Fragen im Zusammenhang mit neurotechnologischen Anwendungen behandelt; technische Themen stehen nicht im Vordergrund. Die UNESCO-Empfehlung ist das Ergebnis eines zweijährigen Prozesses: Ein erster Entwurf wurde von einer Expertengruppe erarbeitet und anschließend in einem umfassenden internationalen Konsultationsprozess diskutiert. Im Mai 2025 kam ein Sonderausschuss, bestehend aus von den Mitgliedstaaten benannten technischen und juristischen Expertinnen und Experten, zusammen, um den Entwurf zu verhandeln und sich auf eine finale Textfassung zu einigen. Diese Fassung wurde im November 2025 formal verabschiedet und bildet nun die Grundlage für nationale Maßnahmen und Regulierung für einen ethischen Einsatz von Neurotechnologien.